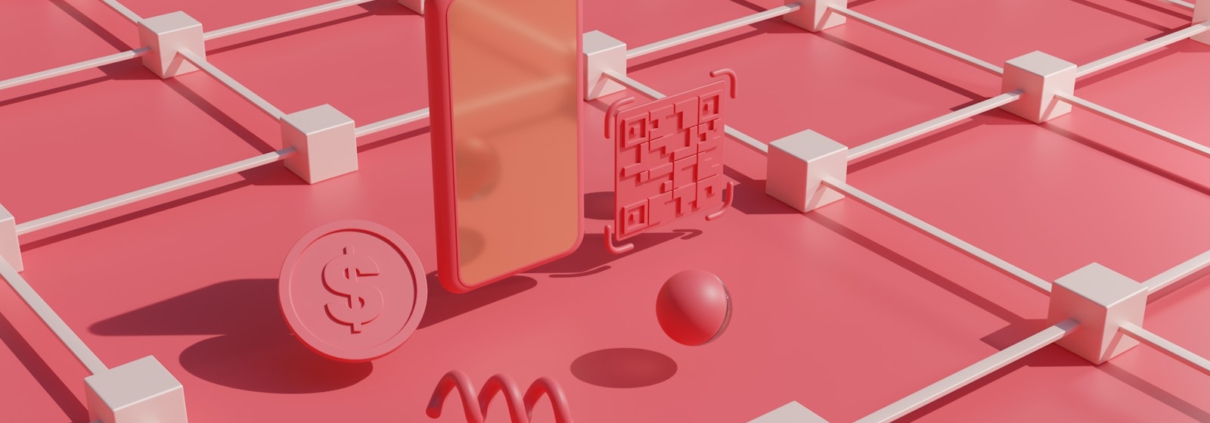AGB-Check Folge 4: Stripe AGB – Was Unternehmen wissen müssen
/in VertragsrechtLEGAL+ NEWS

Stripe gehört zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Zahlungsdienstleistern – und zu den verhandlungsresistentesten. Ein Blick in die Stripe AGB zeigt, warum das problematisch sein kann.
In dieser Serie beleuchten wir die Nutzungsbedingungen großer Dienstleister aus Sicht von Unternehmen, die diese Dienste im Tagesgeschäft einsetzen. Ziel ist es, typische Risikofelder zu erkennen, juristisch einzuordnen und konkrete Hinweise für die Praxis zu geben. Grundlage sind die deutschen Vertragsunterlagen von Stripe mit dem Stand: „Letzte Änderung: 11. November 2024″, bestehend aus dem Rahmenvertrag, den allgemeinen Vertragsbedingungen sowie den besonderen Bedingungen für „Stripe Payments“ und „Stripe Connect“.
Hinweis (Januar 2026): Stripe hat seine Nutzungsbedingungen am 18. November 2025 erneut aktualisiert. Eine deutsche Fassung liegt noch nicht vor. Nach Abgleich mit der aktuellen englischen Fassung sind die hier dargestellten Klauseln inhaltlich unverändert; lediglich die Nummerierung einzelner Ziffern hat sich verschoben. Die rechtliche Bewertung und die Praxishinweise behalten daher ihre Gültigkeit.
Was ist Stripe?
Stripe ist ein international tätiger Zahlungsdienstleister. Unternehmen nutzen Stripe, um Zahlungen von Kunden anzunehmen, Rückerstattungen auszulösen und ausbezahlte Beträge auf das eigene Bankkonto weiterleiten zu lassen. Stripe stellt hierfür technische Schnittstellen (Programmierschnittstellen, sogenannte APIs), grafische Oberflächen (das „Dashboard“) sowie ergänzende Dienste bereit, etwa Betrugsprävention („Radar“) oder Lösungen für Marktplätze („Connect“).
Stripe arbeitet mit sogenannten Acquirern zusammen. Das sind Abwicklungsbanken, die Kartentransaktionen autorisieren und abrechnen. Rechtlich ist zusätzlich relevant, dass die Stripe-Gesellschaft für die eigentlichen Zahlungsdienste in Irland als E-Geld-Institut zugelassen ist. „E-Geld“ meint dabei Guthaben, das elektronisch gespeichert und wie Bargeld zum Bezahlen verwendet werden kann, ohne dass ein klassisches Bankkonto geführt wird.
Vertragspartner und anwendbares Recht
Nach den Stripe AGB ist der Rahmenvertrag in Deutschland als Dreiecksverhältnis ausgestaltet: Stripe Payments Europe Limited ist die zentrale Vertragspartei für den überwiegenden Teil der Leistungen. Für die zugelassenen Zahlungsdienste – also das, was rechtlich als Zahlungsdienst im Sinne des europäischen Rechts gilt – ist die irische Stripe-Gesellschaft als gesonderte Vertragspartei zuständig. Diese Rollenaufteilung wirkt in der Praxis vor allem bei der Haftung und der Zurechnung von Pflichtverletzungen.
Die Verträge stellen auf irisches Recht ab. Streitigkeiten sollen – mit einer Ausnahme für Streitigkeiten über geistiges Eigentum – in einem Schiedsverfahren nach den Regeln der Internationalen Handelskammer (ICC) in Dublin, in englischer Sprache, entschieden werden. Die Verfahrenskosten eines ICC-Schiedsverfahrens liegen selbst bei kleineren Streitwerten regelmäßig im fünfstelligen Bereich. Das setzt eine bestimmte prozessuale Erfahrung voraus und ist für deutsche Unternehmen faktisch eine von Stripe gewollte Hemmschwelle bei der Entscheidung, Forderungen gegenüber Stripe durchzusetzen.
Wichtig: Rechtswahl und Gerichtsstand entfalten erst Wirkung, wenn die Nutzungsbedingungen wirksam in den Vertrag einbezogen wurden (siehe nächsten Punkt).
Geltung der Nutzungsbedingungen – sind sie überhaupt Vertragsinhalt?
Die strengen Regelungen in den Stripe-Bedingungen – etwa irisches Recht und ein Schiedsverfahren in Dublin – wirken nur, wenn diese Bedingungen überhaupt wirksam Teil Ihres Vertrags geworden sind.
In grenzüberschreitenden Verträgen bestimmt die Rom-I-Verordnung, nach welchem Recht sich die Einbeziehung von Geschäftsbedingungen richtet. Diese EU-Verordnung regelt, welches nationale Recht auf internationale Verträge anzuwenden ist. Steht die Rechtswahl selbst noch nicht fest, verweist Rom-I zunächst auf das Recht, das den Vertrag ohne Rechtswahl typischerweise beherrschen würde; bei Zahlungsdiensten führt das häufig nach Irland. Daneben erlaubt Rom-I, sich auf das Recht des eigenen Sitzstaates zu berufen, wenn nach diesem Recht keine wirksame Zustimmung zu den Bedingungen vorliegt.
Die Frage des zuständigen Gerichts ist davon zu trennen: Sie richtet sich nach der Brüssel-Ia-Verordnung, dem zentralen EU-Regelwerk zur internationalen Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen. Schiedsverfahren sind hiervon ausgenommen; ob die in den Stripe-Bedingungen vorgesehene Schiedsklausel greift, hängt wiederum davon ab, ob sie wirksam einbezogen und hinreichend transparent ist.
Was heißt das für die Praxis – und wie lässt sich im Streit „der Weg nach Deutschland“ öffnen?
Entscheidend ist, ob Sie vor Vertragsschluss klar auf die Stripe-Bedingungen hingewiesen wurden, ob der vollständige Text in der maßgeblichen Fassung zugänglich war und ob eine eindeutige Zustimmung vorliegt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Verweisungen auf externe Regelwerke (zum Beispiel Regeln einzelner Zahlungsmethoden) und deren Vorrang. Solche Verweisketten tragen nur, wenn der Bezug eindeutig ist und spätere Änderungen transparent, mit angemessenem Vorlauf und einer realistischen Reaktionsmöglichkeit angekündigt werden.
Fehlen diese Elemente, lassen sich Rechtswahl und Schiedsklausel angreifen – mit dem Ziel, die Zuständigkeit deutscher Gerichte und die Anwendung deutschen Rechts zu erreichen. Praktisch empfiehlt es sich deshalb, bereits beim Abschluss zu dokumentieren, wie die Zustimmung erteilt wurde, welche Texte zugänglich waren und welche Fassung galt.
Klausel: Aufrechnung, Einzug und Rücklagen
In Ziffer 4.2 der allgemeinen Vertragsbedingungen heißt es:
„Stripe ist berechtigt, Gebühren und andere Beträge […] von Ihrem Stripe-Konto abzuziehen, zurückzufordern oder aufzurechnen oder Ihnen diese Beträge in Rechnung zu stellen. […] Stripe kann […] die fälligen Beträge von […] jedem Nutzerbankkonto […] und dem Stripe-Guthaben jedes Stripe-Kontos, welches […] mit Ihnen […] verbunden ist, abbuchen, abziehen, zurückfordern oder aufrechnen.“
In Ziffer 4.3 heißt es weiter:
„Sie ermächtigen Stripe, jedes Nutzerbankkonto […] zu belasten, um Beträge einzuziehen, die Sie im Rahmen dieser Vereinbarung schulden. […] Ihre Ermächtigung […] bleibt in vollem Umfang wirksam, bis […] alle Vergütungen und sonstigen Beträge […] bezahlt sind.“
In Ziffer 5.2 und 5.6 (Payments) wird ergänzt:
„Sofern Ihr Stripe-Kontostand einen negativen Saldo […] aufweist, ist Stripe berechtigt, die Nutzerbankkonten mit dem Betrag zu belasten, der erforderlich ist, um die von Ihnen geschuldeten Beträge einzutreiben.“
„Stripe kann […] den Auszahlungszeitplan ändern oder Auszahlungen verzögern […] eine Rücklage bilden, finanzieren und verwenden […] und mit Beträgen aufrechnen, die eine Stripe-Gesellschaft einer Nutzergesellschaft schuldet.“
Die Stripe-Verträge sehen damit sehr weitreichende Rechte zur Verrechnung und zum Einzug von Beträgen vor. Stripe darf nicht nur Gebühren, Steuern und sonstige fällige Beträge vom Stripe-Guthaben abziehen, sondern auch Nutzerbankkonten belasten. „Nutzerbankkonto“ ist das Konto, das der Händler Stripe angegeben hat. Zudem kann Stripe Rücklagen bilden. Rücklagen sind einbehaltene Gelder, die als Sicherheit dienen.
Die Verträge erlauben Stripe darüber hinaus, mit Forderungen gegen andere Unternehmen derselben Nutzergruppe zu verrechnen; damit sind verbundene Gesellschaften des Händlers gemeint. Schließlich kann Stripe Währungsumrechnungen zu eigenen Kursen vornehmen und hierfür Gebühren erheben.
Was bedeutet das für die Praxis?
Erstens ein unmittelbar spürbares Liquiditätsrisiko. Wenn Stripe Rücklagen erhöht oder belastet, fehlt der Betrag kurzfristig im laufenden Geschäft.
Zweitens ein Steuerungsproblem: Die Trigger für Rücklagen – also die auslösenden Faktoren – sind weit gefasst. Häufig sind es erhöhte Rückbuchungsquoten, offene Erstattungen, ein negativer Saldo oder eine aus Sicht von Stripe gestiegene Risikolage.
Drittens ein Buchhaltungs- und Prüfungsbedarf: Währungsumrechnungen nach Stripe-Kurs und Sammelbuchungen müssen sauber nachvollzogen werden können.
Analyse
Juristisch halte ich diese Klauselgruppe für angreifbar. Sie verschiebt Risiken in erheblichem Umfang auf die Nutzerunternehmen, ohne eine abgestufte Sicherungsmechanik vorzusehen. Nach deutschem Recht sind Allgemeine Geschäftsbedingungen, die zu einer unangemessenen Benachteiligung führen, unwirksam. Auch der Überraschungseffekt spielt eine Rolle: Ein gruppenübergreifender Durchgriff auf Konten verbundener Unternehmen ist jedenfalls nicht das, womit man in marktüblichen Zahlungsdienstleistungsverträgen zwingend rechnet. Zudem bestehen Transparenzmängel, wenn unklar bleibt, was genau „andere Beträge“ umfasst und nach welchen Maßstäben die Reserve bemessen wird.
Praxishinweis
In der Verhandlung sollte man eine Reihenfolge festschreiben (zuerst Verrechnung mit Stripe-Guthaben, dann begrenzte Reserve, keine Belastung externer Konten), Höchstgrenzen und klare Enddaten für Rücklagen vereinbaren und eine Ankündigungsfrist für Abbuchungen vorsehen. Bei Auslandswährungen empfiehlt sich die Festlegung eines Referenzkurses – etwa der Kurs der Europäischen Zentralbank zuzüglich eines festen, niedrigen Aufschlags – sowie die Offenlegung der konkreten Umrechnungsgebühr. Schließlich sollte ein täglicher oder wöchentlicher Ausweis aller Verrechnungen über einen maschinenlesbaren Bericht vereinbart werden, damit die Buchhaltung prüffähig bleibt.
Klausel: Kündigung und Aussetzung
In Ziffer 6.1(b) der allgemeinen Vertragsbedingungen heißt es:
„Stripe kann die Vereinbarung (oder Teile davon) jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mitteilung kündigen oder Ihr Stripe-Konto schließen […].“
In Ziffer 6.2 der allgemeinen Vertragsbedingungen weiter:
„Stripe kann die Erbringung einzelner oder aller Services […] sofort aussetzen, wenn […] (a) Stripe der Ansicht ist, dass dies gegen anwendbares Recht […] verstößt; (b) eine Behörde oder ein Finanzpartner Stripe dazu auffordert; (c) Sie nicht rechtzeitig auf die Nachfrage nach Nutzerinformationen reagieren; (d) Sie gegen diese Vereinbarung […] verstoßen; […] (h) Stripe der Ansicht ist, dass Sie ein […] inakzeptables Risiko darstellen; oder (i) Stripe der Ansicht ist, dass Ihre Nutzung der Services schädlich ist oder sein könnte […].“
Ergänzend Ziffer 2.3 und 2.9(b) der allgemeinen Vertragsbedingungen (Updates/Änderungen):
„Wenn Stripe ein Update zur Verfügung stellt, müssen Sie das Update […] spätestens 30 Tage nach dem Datum der Mitteilung vollständig installieren.“
„Stripe kündigt im Voraus an, wenn eine Änderung oder Einstellung die Funktionalität […] erheblich verringert, außer wenn eine Vorankündigung ein Sicherheitsrisiko darstellen würde oder Rechtspflichten entgegenstehen.“
Stripe kann den Vertrag demnach ohne Angabe von Gründen kündigen und „genehmigt“ sich sehr weitreichende Suspendierungsrechte: Stripe darf Leistungen sofort aussetzen, wenn dies nach Einschätzung von Stripe notwendig oder geboten ist. Auslöser sind zum Beispiel Anfragen von Behörden oder Finanzpartnern, fehlende oder veraltete Nutzerinformationen, ein aus Sicht von Stripe inakzeptables Risiko, erhöhte Betrugsindikatoren oder die nicht fristgerechte Umsetzung von verpflichtenden Updates. Teilweise reichen Formulierungen wie „könnte beeinträchtigen“, also bereits eine prognostische Gefährdung.
Was bedeutet das praktisch?
Unternehmen müssen damit rechnen, dass Zahlungsabwicklung und Auszahlungen kurzfristig unterbrochen werden können. Das betrifft nicht nur neue Zahlungen, sondern auch laufende Vorgänge. Die Pflicht, vorgegebene Änderungen binnen 30 Tagen umzusetzen, erzeugt zusätzlichen Anpassungsdruck, der organisatorisch und technisch zu bewältigen ist. Besonders empfindlich reagieren Strukturen mit regelmäßigen Zahlungen oder mehreren Beteiligten (etwa Marktplatzmodelle), weil Unterbrechungen dort schnell Folgewirkungen entlang der gesamten Abwicklungskette auslösen.
Analyse
Im unternehmerischen Verkehr sind Kündigungs- und Suspendierungsrechte grundsätzlich möglich. In der hier vorgesehenen Breite – eine jederzeitige Kündigung ohne Grund, Sperren bereits bei einer offenen Gefährdungsprognose und kurze Umstellungsfristen – erscheinen die Regelungen in dieser Reichweite fragwürdig.
Gemessen an deutschem AGB-Recht (§ 307 BGB) spricht viel dafür, die Regelungen wegen fehlender Verhältnismäßigkeit und mangelnder Bestimmtheit als unangemessen benachteiligend einzuordnen: Unklare Begriffe wie „inakzeptables Risiko“ oder Formulierungen wie „könnte schädlich sein“ unterstreichen das. Eine abgestufte Vorgehensweise (Hinweis, Gelegenheit zur Abhilfe, Teilmaßnahmen vor Vollsperre) ist nicht vorgesehen. Je nach Einzelfall kommt zudem ein Überraschungsmoment in Betracht (§ 305c Abs. 1 BGB). Insgesamt erscheinen die Klauseln daher angreifbar und bieten im Streitfall Ansatzpunkte für Verhandlungen.
Praxishinweis
Vor Vertragsschluss sollte geklärt und möglichst von Stripe schriftlich bestätigt werden, wie Stripe mit Sperren, Kündigungen, Rücklagen, Aufrechnung und Updatepflichten konkret umgeht (Ankündigung, Fristen, Behandlung bereits autorisierter Zahlungen). Wenn die Verhandlungsmacht es zulässt, sind behutsame Präzisierungen sinnvoll – etwa eine abgestufte Vorgehensweise vor Vollsperren, nachvollziehbare Schwellen für „Risiko“ und angemessene Fristen für nicht sicherheitskritische Änderungen. Wo das nicht erreichbar ist, empfiehlt sich die praktische Absicherung: interne Abläufe für Störfälle sowie eine belastbare Ausweichmöglichkeit für die Zahlungsabwicklung.
Klausel: Haftungsbegrenzung und Gewährleistung
In Ziffer 12.1 der allgemeinen Vertragsbedingungen heißt es:
„Stripe stellt die Services und die Stripe-Technologie im gegenwärtigen Zustand (‚as is‘) zur Verfügung … [und] lehnt alle ausdrücklichen und konkludenten Garantien ab …“
In Ziffer 12.2 der allgemeinen Vertragsbedingungen heißt es weiter:
„Die Stripe-Parteien haften … nicht für indirekte, beiläufige, Folge-, besondere oder Strafschäden…“
„Die Gesamthaftung … übersteigt nicht den höheren Betrag von (i) den von Ihnen in den letzten drei Monaten gezahlten Gebühren oder (ii) 500 USD.“
In Ziffer 12 der Stripe-Payments-Bedingungen heißt es ergänzend:
„Die Haftungsbeschränkung nach Ziffer 12.2(b) gilt nicht für Ansprüche, wonach Abrechnungsbeträge nicht überwiesen wurden; hierfür ist die Haftung auf den Betrag begrenzt, den Stripe erhalten hat und schuldet, aber nicht überwiesen hat.“
Stripe gibt demnach keine inhaltlichen Leistungszusagen, schließt weite Schadenskategorien aus und deckelt die verbleibende Haftung auf drei Monatsgebühren oder 500 US-Dollar. Nur wenn vereinnahmte Abrechnungsbeträge nicht weitergeleitet werden, haftet Stripe bis zur Höhe dieses Betrags; weitergehende Folgeschäden sind auch dann nicht umfasst.
Was bedeutet das praktisch?
Größere Vermögensschäden aus Störungen der Zahlungsabwicklung – etwa Ausfälle, Verzögerungen oder fehlerhafte Risikobewertungen – lassen sich auf Grundlage dieser Klauseln regelmäßig nicht durchsetzen. Selbst bei Pflichtverletzungen bleibt der Ersatz typischerweise sehr niedrig. Die Sonderöffnung bei nicht weitergeleiteten Auszahlungen beschränkt sich auf den reinen Auszahlungsbetrag.
Analyse
Aus deutscher AGB-Perspektive (§ 307 BGB) erscheinen die Regelungen in dieser Dichte – „as is“, breite Ausschlüsse ganzer Schadenskategorien und eine sehr niedrige Gesamthaftung, die an wenige Monatsgebühren anknüpft – angreifbar. Besonders ins Gewicht fällt, dass der Kern der Leistung (Abwicklung, Verwahrung, Auszahlung) nur minimal abgesichert ist und gesetzliche Leitplanken nicht ausdrücklich abgebildet werden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Personenschäden sowie ein angemessener Ersatz bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten).
Das eröffnet im Streitfall Ansatzpunkte, Reichweite und Anwendung der Klauseln zu begrenzen. Auch nach irischem Vertragsrecht sind Haftungsbeschränkungen zwar grundsätzlich zulässig, unterliegen aber einer engen Auslegung; unklare oder sehr weit gefasste Klauseln – insbesondere bei zentralen Vertragspflichten – werden zurückhaltend angewendet, Mehrdeutigkeiten gehen zulasten des Verwenders. Die rechtliche Stoßrichtung ist damit vergleichbar: Sehr weit formulierte Haftungsdecks lassen sich, je nach Sachverhalt, auch unter irischem Recht angreifen.
Praxishinweis
In der Anbahnungsphase sollte geklärt und – wenn möglich – kurz schriftlich festgehalten werden, dass für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit keine Begrenzung gilt, Personenschäden unberührt bleiben und bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ein angemessener Ersatz vorgesehen ist. Soweit die Verhandlungsmacht es erlaubt, empfiehlt sich eine sachgerechte Kappung, die sich nicht an Gebühren, sondern an einem realistischen Mehrmonatsvolumen orientiert, sowie eine Klarstellung, dass bei Auszahlungs-, Verwahr- und Datensicherheitsfehlern nicht nur der Nettobetrag, sondern der adäquate Vermögensschaden ersatzfähig bleibt.
Wo Anpassungen nicht erreichbar sind, sollten Versicherungsschutz und eine tragfähige operative Ausweichmöglichkeit die wirtschaftlichen Risiken abfedern.
Stripe ist im Markt gesetzt. Die rechtliche Ausgestaltung des von Stripe vorgegebenen Regelwerks fällt jedoch deutlich zugunsten von Stripe aus. Besonders negativ ins Gewicht fallen – wie oben beschrieben – der weitreichende Zugriff auf Gelder durch Aufrechnung, Einzug und Rücklagen, die Möglichkeit kurzfristiger Sperren und Kündigungen sowie eine sehr niedrige Haftungsdecke.
Wenn machbar, sollte man die Annahme des Standardwerks an klare Nebenabreden knüpfen.


AKTUELLE BEITRÄGE
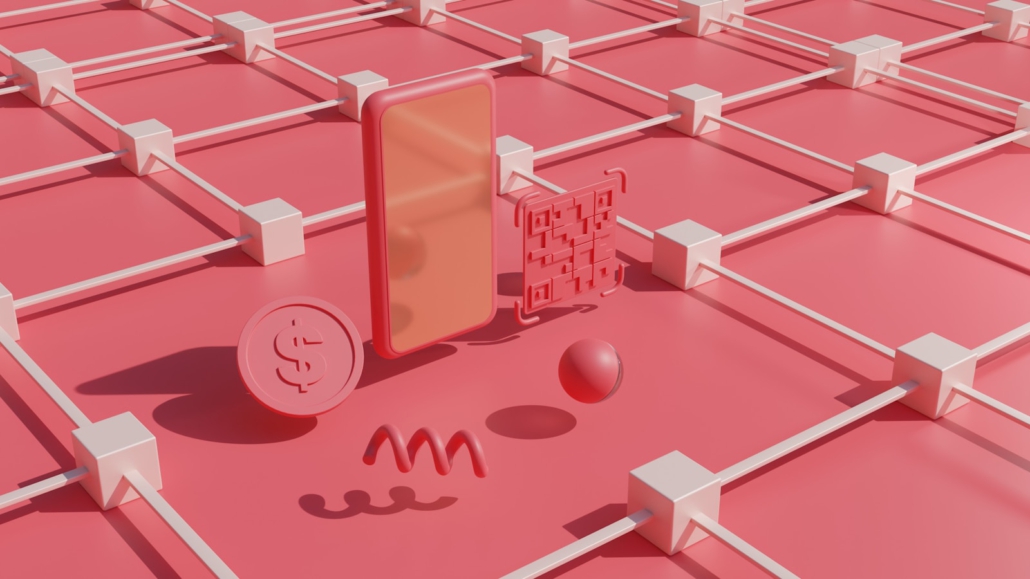
AGB-Check Folge 4: Stripe AGB – Was Unternehmen wissen müssen
Stripe gehört zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Zahlungsdienstleistern – und zu den verhandlungsresistentesten. Ein Blick in die Vertragsbedingungen zeigt, warum das problematisch sein kann.

YouTube-AGB für Unternehmen: Monetarisierung und Embeds im Praxischeck
YouTube ist für Unternehmenskommunikation Standard. Der Beitrag beleuchtet das allgemeine Monetarisierungsrecht von YouTube und die Regeln für Embeds aus Unternehmenssicht und zeigt, welche Folgen das für Werbeumfeld, Hosting-Strategie und eigene Vermarktung hat.

Ermittlung von Handelsbräuchen im Zivilprozess
Der nachfolgende Beitrag setzt sich damit auseinander, wie Handelsbräuche in gerichtlichen Verfahren ermittelt werden und was es für die Beteiligten zu beachten gilt.
KONTAKT

+49 (40) 57199 74 80
+49 (170) 1203 74 0
Neuer Wall 61 D-20354 Hamburg
kontakt@legal-plus.eu
Profitieren Sie von meinem aktiven Netzwerk!
Ich freue mich auf unsere Vernetzung.